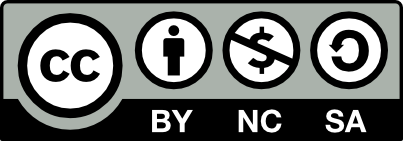Argentinien: Reiches Land - arme Menschen (Moneycracy #14)
ID 129469
Wir hatten beschlossen, uns mit den Auswirkungen der Herrschaft des Geldes auf den globalen Süden unter einer postkolonialen Sichtweise für einige Folgen zu beschäftigen und beginnen mit Argentinien. Der aktuelle Anlass besteht im Besuch des sehr skurrilen Politikers Millei in Deutschland, um ein wenig mit Olaf Scholz zu plaudern und einen Wirtschaftspreis in Empfang zu nehmen. Der Präsidenten des zweitgrößten südamerikanischen Landes ist eigentlich Ökonom, gilt in der Selbst- und Fremdzuschreibung jedoch als Anarcho-Liberaler.
Audio
29:37 min, 28 MB, mp3
mp3, 130 kbit/s, Stereo (44100 kHz)
Upload vom 24.06.2024 / 18:39
29:37 min, 28 MB, mp3
mp3, 130 kbit/s, Stereo (44100 kHz)
Upload vom 24.06.2024 / 18:39
Dateizugriffe: 492
Klassifizierung
Beitragsart: Gebauter Beitrag
Sprache: deutsch
Redaktionsbereich: Wirtschaft/Soziales, Internationales, Politik/Info
Serie: Moneycracy
Creative Commons BY-NC-SA
Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen erwünscht
Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen erwünscht
Skript
Wir hatten beschlossen, uns mit den Auswirkungen der Herrschaft des Geldes auf den globalen Süden unter einer postkolonialen Sichtweise für einige Folgen zu beschäftigen und beginnen mit Argentinien. Der aktuelle Anlass besteht im Besuch des sehr skurrilen Politikers Milei in Deutschland, um ein wenig mit Olaf Scholz zu plaudern und einen Wirtschaftspreis in Empfang zu nehmen. Der Präsidenten des zweitgrößten südamerikanischen Landes ist eigentlich Ökonom, gilt in der Selbst- und Fremdzuschreibung jedoch als Anarcho-Liberaler. Anarchistisches kann in seinen Positionen schwerlich erkannt werden, wenn man nicht skurrile, erratische und irrationale Positionen mit Anarchismus verwechselt. Aber weshalb ein solcher Clown auf die mächtigste Position eines großen Landes gewählt werden konnte, kann anhand der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Verteilung der Machtressource Geld durchaus erklärt werden. Wir beschäftigen uns daher zunächst mit der Wirtschaftshistorie des Landes und der über Jahrzehnte beständig zunehmenden Armut der argentinischen Gesellschaft, was erst die Vorraumsetzungen schuf, um das argentinische Volk zu einer solchen Verzweiflungswahl zu treiben.
Argentinien gehörte, und das ist wahrscheinlich für die meisten Hörerinnen neu, vor dem Ersten Weltkrieg zu den 10 reichsten Staaten dieser Erde. Noch um 1960 war das Prokopfbruttosozialprodukt höher als das von Ländern wie Italien, Japan und Österreich. Es sei gleich angemerkt, dass diese Kennzahl kein guter Maßstab für kollektiven oder individuellen Reichtum einer Gesellschaft ist, wie wir auch später noch genauer sehen werden. Zur begrenzten Aussagekraft des angebetenten Bruttosozialprodukts haben wir einen Podcast gemacht, durch den ihr euch gerne weiter informieren könnt.
Dennoch, Argentinien, ein Land, das die Hoffnung auf Reichtum in Form von Edelmetallen schon im Namen trägt, gehörte lange Zeit zu den nominell wohlhabenden Gesellschaften. Die meisten Menschen heute kennen den südamerikanischen Staat jedoch als Dauerpleitekandidat, dessen Währung regelmäßig zusammenbricht und dessen Wirtschaft überhaupt nicht funktioniert. Wie konnte es zu einen solchen negativen Entwickelung kommen?
Argentinien wurde 1816 während der großen lateinamerikanischen Freiheitsbewegung von der spanischen Kolonialmacht unabhängig. In den folgenden Jahrzehnten des19. Jahrhunderts kam es zu einem großen wirtschaftlichen Aufschwung, da das Land über viel fruchtbaren Ackerboden verfügt und daher eine blühende Landwirtschaft entwickeln konnte. Über einen langen Zeitraum war daher Argentinien nach den USA das Hauptauswanderungsland für EuropäerInnen, die ein besseres Leben suchten. Sie fanden es in den den fruchtbaren Weiten Südargentinien, wobei an dieser Stelle betont werden muss, dass die EinwanderInnen das Land von den dort bereits lebenden UreinwohnerInnnen stahlen. Der Landraub und Völkermord in Argentinien unterschied sich nicht von dem Vorgehen in den USA, Die Millionen Europäer, die im 19. Jahrhundert in dieses neue Siedlungsgebiet kamen, brauchten Ackerland und um Platz für sie zu schaffen, wurde in Argentinien eine gezielte Vertreibung samt Genoziden begangen. Als Folge dieser Abläufe, ist der indigene Bevölkerungsanteil in Argentinien heute deutlich geringer als in vielen lateinamerikanischen Staaten. Aber zurück von den dunklen rassistischen Säuberungen zur wirtschaftlichen Entwicklung in Argentinien.
Diese war, wie bereits erwähnt, sehr stark durch eine erfolgreiche Landwirtschaft bestimmt. Riesige Felder und noch riesigere Weiden prägten und prägen das Land. Das Argentinische Steak, das sich bis heute auf Speisekarten vieler deutscher Gasthäuser findet, war einer der Exportschlager. Darüber hinaus finden sich, vor allem im Nordosten des Landes um Cordoba zahlreiche Bodenschätze, vor allem Metalle, die gewinnbringend exportiert werden konnten.
Diese guten natürlichen Bedingungen schufen die Vorraumsetzungen für einen langanhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung, der ähnlich auch in anderen Teilen Südamerikas bis zur großen Weltwirtschaftskrise 1930 zu verzeichnen war. Aber nirgendwo waren die natürlichen Gegebenheiten so gut wie in Argentinien, das deshalb als lateinamerikanisches Gegenstück zu den USA im Norden des Doppelkontinents gesehen wurde.
Tatsächlich wiesen beide Staaten gewissen strukturelle Gemeinsamkeiten auf: sie waren beide Top-Destinationen für europäische Auswanderer, besaßen großräumige agrarisch nutzbare Flächen und waren mit zahlreichen, recht einfach erschließbaren Bodenschätzen gesegnet. Allerdings, das ist für unsere Fragestellung und die weitere Entwicklung interessant, gab es auch wichtige Unterschiede. Argentinien war nur eine Scheindemokratie, die von einer verschwindet kleinen oligarchen Oberschicht beherrscht und ausgebeutet wurde. Der Reichtum Argentiniens war stets im Wesentlichen der Reichtum sehr weniger Familien. Die sozialen Verhältnisse waren zementiert, ein relevanter sozialer Aufstieg war, anders als in den USA, praktisch unmöglich. Die Politik des Landes reflektierte daher auch in den sogenannten Goldenen Jahrzehnten zwischen 1860 und 1930 nur die Rivalitäten der wenigen zentralen Familien des Landes. Während die Mächtigen damit beschäftigt waren, sich ihre Reichtümer gegenseitig streitig zu machen, konnte sich sehr weit unterhalb dieser Reichtumsphäre auch eine kleinbürgerliche Schicht etablieren, die in relativer Freiheit des großräumigen Landes ihr eigenes Leben führen konnte, solange sie die Kreise und Intrigen der Oligarchie nicht störten. Für viele Millionen Auswanderer war dieses kleine Glück genug.
Der Erste Weltkrieg verschlechterte jedoch die ökonomische Lage weltweit und besonders im exportorientierten Argentinien. Dadurch wurde der bisherige Gesellschaftsvertrag infrage gestellt, der durch eine riesige Luxustafel für Wenige und einen ausreichend mit Brosamen bestückten Katzentisch für die Vielen gekennzeichnet war.
1912 war das allgemeine Wehrrecht für Männer eingeführt worden, was 1916 durch die Verarmung breiter Bevölkerungsschichten erstmals zu einer als sozialdemokratisch bis linksliberal einzuordnenden Regierung führte. Diese wurde in ihrer politischen Gestaltrungskraft jedoch rasch durch interne Machtkämpfe gehemmt. Entsprechend änderte sich an den gesellschaftlichen Verhältnissen und der sehr ungleichen Eigentumsverteilung so gut wie nichts.
Die Weltwirtschaftskrise ab 1930 traf Argentinien zwar nur mäßig hart, aber als Reaktion kam es zu einem rechts-autoritären Putsch wie in vielen Teilen der Welt in diesen besonders schwierigen Zeiten. Damit waren die Verhältnisse wieder auf dem Niveau von vor 1916 angelangt: Operetten-Präsidenten aus der Oligarchie sorgten dafür, dass die Großgrundbesitzer und Bergbau-Magnaten weiter ungestört ihre Millionen scheffeln konnten und den 90 Prozent armen Menschen ging es eben so schlecht, wie es armen Leute in den dreißiger Jahren des letzten Jahrhundert nun mal ging.
Der Zweite Weltkrieg wirkte sich für ganz Südamerika relativ positiv aus, da keines der Länder direkt involviert oder gar betroffenen war und der Bedarf der Kriegsparteien an Nahrungsmitteln und Rohstoffen sich als immens erwies.
Der bescheidene Aufschwung wirkte sich auch am Katzentisch aus und stärkte das Selbstbewusstsein der Gewerkschaften- Die sorgten dafür, dass ab 1946 der Offizier Juan Peron an die Macht kam, der eine Art rechtspopulistische Form der Machtausübung etablierte, in denen erstmals auch Interessen außerhalb der vierzig führenden Familien des Landes wahrgenommen wurden. Das brachte spürbare Verbesserungen für die Masse der normalen ArgentinerInnen, jedoch soll auch erwähnt werden, dass Perons Herangehehnsweise sich rechtsnational mit sozialen Einschlag verortete. Seine aus Film und Musical bekannte Frau Evita hatte großes Massenpopulistisches Talent und unterstützte effektiv den Machterhalt ihres Gatten. Perons Verdienst liegt sicher in der in Angriff genommenen Industrialisierung, wodurch erstmals dann nicht nur der Agrarsektor und die Rohstoffe zur wirtschaftlichen Gesamtleistung beitrugen. In Perons zehnjährige Herrschaft fallen das erste argentinische Auto und Flugzeug, es entstand ein verarbeitendes Gewerbe, sodass Rohstoffe bereits im Land veredelt werden konnte und damit ein wichtiger Teil der Wertschöpfungskette in der heimischen Wirtschaft verblieb. Zahlreiche deutsche Ingenieure und Techniker fanden nach dem Zweiten Weltkrieg eine zweite Heimat in Argentinien, wo sie vor unangenehmen Fragen, was sie währen der nationalsozialistischen Herrschaft so gemacht hatten, sicher waren.
Weil das hier ein Wirtschafts- und kein Geschichtspodcast ist, sehen wir uns nun die Aspekte der Wirtschaftspolitik Perons genauer an. Wie fast alle Nationalisten fuhr er eine strenge protektionistische Handelspolitik – Importe wurden erschwert bis verunmöglicht – was eben dann auch zum ersten argentinischen Auto, Flugzeug, Nähmaschinenhersteller und so weiter führte. Ebenfalls passend in nationale Schema waren eine deutlich staatsdirigistische Wirtschaftspolitik, welche die stark in die Abläufe eingriff und ihm die Gegnerschaft der Oligarchie einbrachte, über die er später stürzen würde. Weiterhin schob Peron viele industrielle Großprojekte wie Straßenbau, Flughäfen und anderes an und verstaatlichte die großen Industrien. Die staatlich dirigierte Wirtschaft wurde über Fünfjahrespläne geleitet, Preise z.B. in den Restaurants oder für Nahrungsmittel waren festgesetzt und freie markwirtschaftliche Aktiviäten konnten nur noch in Nischenbereichen stattfinden.
Viele dieser Maßnahmen fanden sich damals vergleichbar in staatssozialistischen Ländern, insbesondere auch in der Sowjetunion. Dennoch war Peron kein Linker, ebenso wenig wie die staatssozialistischen Diktaturen jemals wirklich links waren. Peron strebte für Argentinien nach nationaler Größe, was durch Industrialisierung und Aufholen des Abstands zur Supermacht USA gelingen sollte.
Wirtschaftlich und gesellschaftlich änderte sich in den zehn Jahren von Perons Herrschaft allerdings alles. Der Einfluss der Großgrundbesitzer nahm ab, Bergwerke wurden verstaatlicht und Millionen von Menschen arbeiteten erstmals nicht mehr für die reichen Familien sonderen in den staatlichen Industrien oder in neu entstandenen Firmen, die wir heute neudeutsch Start-Ups nennen würden.
Dies schuf erstmals in Argentinien einen breiteren Massenwohlstand. Obwohl hier im Vergleich für die ganz große Masse kein allzu gutes Niveau erreicht wurde, haben Wirtschaftswissenschaftler errechnet, dass es den ArgentinierInnen nie wieder so gut ging, wie unter Peron. Das ist eine krasse Feststellung, denn inzwischen sind 68 Jahre vergangen und man muss lange suchen, um einen Staat zu finden, dessen Menschen heute schlechter als vor 70 Jahren leben.
Was sind die Ursachen für diese bedauerliche Abwärtsentwicklung?
Zunächst muss festgestellt werden, dass die Wirtschaftspolitik Perons zahlreiche Erfolge und auch viele Misserfolge aufweist. Was überwiegt scheint schwer herauszuarbeiten, denn das Ergebnis hängt, wie so oft davon ab, was der Forscher zu finden wünscht. Objektiv lässt sich sagen, dass Argentinien am Ende von Perons zweiter Amtszeit sich in eher langsamen wirtschaftlichen Entwicklung vergleichbar mit anderen lateinamerikanischen Ländern befand. Wenn wir das allerdings einmal auffieseln können wir sagen:
Der Masse der ArgetinierInnen ging 1955 besser als je zuvor, und wie heute wissen, auch jemals danach.
Die Oligarchen-Familien hatten Einbußen hinzunehmen, auch weil eben der Agrarsektor nicht mehr so im Vordergrund stand – lebten aber weiterhin überdurchschnittlich gut, Wenn wir es etwas plakativ formulieren wollen: es konnte nur noch alle zwei Jahre eine neue Yacht gekauft werden.
Auch andere Machtinstitutionen wie die katholische Kirche musste Verluste hinnehmen und bekämpfte die neue Politik erbittert..
Peron musste für seinen großen Sprung nach vorne viele Schulden machen, die allmählich zu drücken begannen. Er konnte zahlreiche seiner Programme mehr nicht so leicht finanzieren. Die staatlich festgelegten Preise mussten angehoben werden, gleichzeitig sank das Lohnniveau partiell oder stieg zumindest nicht im inzwischen gewohnten Maße. Die Gewerkschaften, die ihre Interessen nicht mehr wie gewünscht umgesetzt sahen, entzogen Peron die Machtbasis und es kam zu einem Putsch.
Politisch kam es in den Folgejahre zu instabilen Situationen und vielen Wechseln. Alle Akteure hatten jedoch von der Oligarchie einen klaren Auftrag erhalten: Perons Reformen rückgängig zu machen! Die verschiedenen Operetten-Präsidenten lieferten: Privatiserung der Staatsbetriebe und der Infrastruktur, Abbau von Zöllen und Handelshemmnissen, Abbau von Sozialleistungen und staatlichen Sicherheiten, Preisfreigabe und Reduktion des staatlichen Sektors.
Wenn mal ein Präsident nicht so funktionierte wie gewünscht, sich einfach ungeschickt anstellte oder das Volk zu viel Widerstand bot, dann putschte eben das Militär.
Die Folgen waren wie gewünscht: die Oligarchen-Familien saßen wieder fest im Sattel der Macht, auf dem Präsidententhron tummelten sich willfährigen Marionetten, die Geschäfte der Großagrarier liefen wieder wie geschmiert und das ganze Industriezeug ließ man wieder sein, weshalb Argentinien ab 1960 wieder fast ausschließlich Nahrungsmittel und Rohstoffe exportierte.
Nicht überraschend verarmte die Bevölkerung bei diesem Wandel, was durch eine hohe Geldentwertung - Inflationsraten durch die Jahrzehnte um 40 Prozent pro Jahr - zusätzlich verschärft wurde.
Es muss klar ausgesprochen werden: die Politik der Nach-Peron Zeit in Argentinien war grottenschlecht, weil das die Elite so wünschte und das Wohlergehen des Volks egal war. Das mündete in ein so solches gesellschaftliches und wirtschaftliches Chaos, das Argentinien vom Primus in Lateinamerika fast zum Schlusslicht abstieg. In der Not holte man 1973 sogar Peron aus dem Exil zurück, der aber bis zu seinem Tod ein Jahr später nichts Substantielles mehr ausrichten konnte. Danach kam seine dritte Frau – also nicht Evita, sondern Ehefrau Nummer drei namens Isabel formal an die Macht, war aber nur ein Aushängeschild rechter Peronisten, die Fäden zogen, besser gesagt: immer mehr aus der Hand verloren. Guerrillagruppen und Paramilitärs führten lokale Bürgerkriege und der Abstieg zum failed state war komplett. Natürlich putschte mal wieder das Militär und eine rechte Junta sorgte mit Terror und Folter für Ordnung und Ruhe im Staat. Wirtschaft war da nebensächlich, riesige Inflationsraten und eine Staatspleite 1982 waren die Folge. Die Generäle suchten nach altem Muster das Heil im militärischen Abenteuer, hatten sich aber bei der Besetzung der Falklandinseln den falschen Spielpartner herausgesucht. Die Briten warfen die Argentinier von der Insel und die Generäle dankten ab. Sie hinterließen ein psychologisch und wirtschaftlich völlig zerstörtes Land. Bis 1989 war Argentinien zahlungsunfähig. Erst mit den sogenannten Brady-Bonds, nach dem damaligen US-Finanzminister Brady benannt, konnte schließlich wieder schrittweise finanzielle Bewegungsfreiheit für das marode Land hergestellt werden. Die Brady-Bonds funktionierten vereinfacht so: Ein Darlehngsgeber hat Schuldverschreibung über 2 Millionen Pesos. Diese sind wertlos, weil der Pesos praktisch wertlos ist und außerdem Argentinien nicht zahlen kann. Dieser Schuldschein kann dann der Kreditgeber, es sei in unserem Beispiel eine Bank, in einen Bradybond von 20.000 Dollar umwandeln. Damit macht sie zwar Verlust, aber sie hat eine gesicherte Schuldverschreibung in einer handelbaren Währung auf die sie sogar weiter Zinsen bekommt. So kam Argentinien aus Pleite, bis zum nächsten mal, nur elf Jahre später, 2001.
Nach dem Ende der Militärdiktaturen kamen wechselnde demokratische gewählte Politiker an die Macht, immer wieder auch sogenante Peronisten, die der Partei Juan Peron angehörten, aber nicht daran dachten, seine Wirtschafts- und Sozialpolitik zu betreiben.
Im Prinzip entwickleten sich die Peronisten nach dem Ende der Militärdiktatur ab 1983 zur größten Volkspartei Argentiniens, die sich in einen sozialdemokratischen und einen wirtschaftsliberalen Flügel teilt. Weder der einen noch der anderen Richtung gelang es in den letzten 20 Jahren, Argentinien wieder aus dem Sumpf zu ziehen. Mehrere Staatspleiten, Währungsreformen und Krisenjahrzehnte später, steht Argentinien weiter mit eineinhalb Füßen im Abgrund.
Dabei fehlte es nicht an radikalen Maßnahmen. Wegen des eigentlich seit 1956 bestehenden Problems der massiven Inflation kam der neoliberale Präsident Menem 1991 auf den Gedanken, den Peso fix 1 zu 1 an den Dollar zu binden. Die Grundprinzipien der Wechselkurse und die Probleme eine Währungsbindung haben wir schon in unserem Podcast zu Währungen besprochen – bei Interesse gerne nachhören.
Menem erreichte zunächst sein Ziel, die Inflation sank erstmals seit Jahrzehnten. Zu welchen Preis, das wollen wir uns jetzt zum Abschluss ansehen. Die Prinzipien der Währungsbindung erforderte, dass für jeden Peso der im Umlauf war, ein Dollar auch als Devisenreserve vorgehalten werden musste. Da sie gar nicht so viele Dollar beßaß, wie benötigt, musste die Regierung daher den Peso-Umlauf begrenzen. Übersetzt bedeutet das: der Peso war zwar stabil, aber die Leute bekamen nur sehr wenige davon, die Möglichkeit Geld bar abzuheben wurde begrenzt.
Der nächste Nachteil bestand in allgemein steigenden Preisen. Wegen der Dominanz des Dollars im Weltwirtschaftssystem haben fast alle Waren einen internationalen Dollarpreis. Wenn der Peso jetzt 1 zu 1 an den Dollar gekoppelt ist, dann werden diese Waren auch in Argentinien dieses internationale Preisniveau aufweisen. Normalerweise sind in einem einkommensschwachen Schwellenland jedoch die Preise niedriger als das internationale Niveau. Das gleiche Prinzip wirkte sich in umgekehrter Weise auf die Löhne aus. Da die ArgentinierInnen nun im Prinzip Löhne in der Hartwährung Dollar erhielten, mussten diese in einem marktwirtschaftlichen System zwangsläufig sinken, denn das Produktivitätsniveau gab es nicht her, den Peso-Lohn quasi 1 zu 1 in Dollarlohn zu überführen. Die Folge für die Masse der ArgentinierInnen waren also steigende Preise und sinkende Löhne, was den positiven Effekt der Geldstabilität weitgehend wieder aufhob.
Am ungünstigsten wirkte sich jedoch aus, dass das Grundwirkprinzip der Wechselkurse, die Stärke einer Volkswirtschaft in ihrem Wechselkurs-Wert widerzuspiegeln, außer Kraft gesetzt wurde. Normalerweise wäre der argentinische Peso sehr wertarm gewesen, damit wären die Exporte des Landes preisgünstig und konkurrenzfähig gewesen. So aber konnte Nachbarländer wie Brasilien, die teilweise ganz ähnliche Waren exportierten, Argentinien fast völlig aus dem Markt drängen.
Bei der nächsten große Pleite 1998 wurde das Experiment daher als gescheitert abgebrochen.
Seither sind 25 Jahre vergangen, die Lage hat sich nicht gebessert.
So haben die Menschen nach eigentlich ziemlich langer Gedulds- und Leidenszeit jedes Vertrauene in eine herkömmliche Regierung verloren und einen wenig geeignet erscheinenden Kettensägen-Freak an die Spitze gewählt. Der will nicht nur das Dollarexperiment eine Stufe höher wiederholen, indem er den Peso ganz abschafft, sondern glaubt auch keine Zentralbank mehr zu brauchen.
Das Leiden der argentinischen Menschen geht weiter.
Die unerfreuliche Geschichte zeigt, wie ein von Natur aus reiches Land durch eine kleine egoistische Elite und korrupte PolitikerInnen über Jahrzehnte in Armut und gesellschaftlichen Chaos gehalten werden kann.
Episode und Musik von Frederick Liberatout.
Anregung und Kritik an moneycracy@riseup.net
This podcast features music created by F. Liberatout using Groovepad. Free available on Google Play and Apple Store,
Argentinien gehörte, und das ist wahrscheinlich für die meisten Hörerinnen neu, vor dem Ersten Weltkrieg zu den 10 reichsten Staaten dieser Erde. Noch um 1960 war das Prokopfbruttosozialprodukt höher als das von Ländern wie Italien, Japan und Österreich. Es sei gleich angemerkt, dass diese Kennzahl kein guter Maßstab für kollektiven oder individuellen Reichtum einer Gesellschaft ist, wie wir auch später noch genauer sehen werden. Zur begrenzten Aussagekraft des angebetenten Bruttosozialprodukts haben wir einen Podcast gemacht, durch den ihr euch gerne weiter informieren könnt.
Dennoch, Argentinien, ein Land, das die Hoffnung auf Reichtum in Form von Edelmetallen schon im Namen trägt, gehörte lange Zeit zu den nominell wohlhabenden Gesellschaften. Die meisten Menschen heute kennen den südamerikanischen Staat jedoch als Dauerpleitekandidat, dessen Währung regelmäßig zusammenbricht und dessen Wirtschaft überhaupt nicht funktioniert. Wie konnte es zu einen solchen negativen Entwickelung kommen?
Argentinien wurde 1816 während der großen lateinamerikanischen Freiheitsbewegung von der spanischen Kolonialmacht unabhängig. In den folgenden Jahrzehnten des19. Jahrhunderts kam es zu einem großen wirtschaftlichen Aufschwung, da das Land über viel fruchtbaren Ackerboden verfügt und daher eine blühende Landwirtschaft entwickeln konnte. Über einen langen Zeitraum war daher Argentinien nach den USA das Hauptauswanderungsland für EuropäerInnen, die ein besseres Leben suchten. Sie fanden es in den den fruchtbaren Weiten Südargentinien, wobei an dieser Stelle betont werden muss, dass die EinwanderInnen das Land von den dort bereits lebenden UreinwohnerInnnen stahlen. Der Landraub und Völkermord in Argentinien unterschied sich nicht von dem Vorgehen in den USA, Die Millionen Europäer, die im 19. Jahrhundert in dieses neue Siedlungsgebiet kamen, brauchten Ackerland und um Platz für sie zu schaffen, wurde in Argentinien eine gezielte Vertreibung samt Genoziden begangen. Als Folge dieser Abläufe, ist der indigene Bevölkerungsanteil in Argentinien heute deutlich geringer als in vielen lateinamerikanischen Staaten. Aber zurück von den dunklen rassistischen Säuberungen zur wirtschaftlichen Entwicklung in Argentinien.
Diese war, wie bereits erwähnt, sehr stark durch eine erfolgreiche Landwirtschaft bestimmt. Riesige Felder und noch riesigere Weiden prägten und prägen das Land. Das Argentinische Steak, das sich bis heute auf Speisekarten vieler deutscher Gasthäuser findet, war einer der Exportschlager. Darüber hinaus finden sich, vor allem im Nordosten des Landes um Cordoba zahlreiche Bodenschätze, vor allem Metalle, die gewinnbringend exportiert werden konnten.
Diese guten natürlichen Bedingungen schufen die Vorraumsetzungen für einen langanhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung, der ähnlich auch in anderen Teilen Südamerikas bis zur großen Weltwirtschaftskrise 1930 zu verzeichnen war. Aber nirgendwo waren die natürlichen Gegebenheiten so gut wie in Argentinien, das deshalb als lateinamerikanisches Gegenstück zu den USA im Norden des Doppelkontinents gesehen wurde.
Tatsächlich wiesen beide Staaten gewissen strukturelle Gemeinsamkeiten auf: sie waren beide Top-Destinationen für europäische Auswanderer, besaßen großräumige agrarisch nutzbare Flächen und waren mit zahlreichen, recht einfach erschließbaren Bodenschätzen gesegnet. Allerdings, das ist für unsere Fragestellung und die weitere Entwicklung interessant, gab es auch wichtige Unterschiede. Argentinien war nur eine Scheindemokratie, die von einer verschwindet kleinen oligarchen Oberschicht beherrscht und ausgebeutet wurde. Der Reichtum Argentiniens war stets im Wesentlichen der Reichtum sehr weniger Familien. Die sozialen Verhältnisse waren zementiert, ein relevanter sozialer Aufstieg war, anders als in den USA, praktisch unmöglich. Die Politik des Landes reflektierte daher auch in den sogenannten Goldenen Jahrzehnten zwischen 1860 und 1930 nur die Rivalitäten der wenigen zentralen Familien des Landes. Während die Mächtigen damit beschäftigt waren, sich ihre Reichtümer gegenseitig streitig zu machen, konnte sich sehr weit unterhalb dieser Reichtumsphäre auch eine kleinbürgerliche Schicht etablieren, die in relativer Freiheit des großräumigen Landes ihr eigenes Leben führen konnte, solange sie die Kreise und Intrigen der Oligarchie nicht störten. Für viele Millionen Auswanderer war dieses kleine Glück genug.
Der Erste Weltkrieg verschlechterte jedoch die ökonomische Lage weltweit und besonders im exportorientierten Argentinien. Dadurch wurde der bisherige Gesellschaftsvertrag infrage gestellt, der durch eine riesige Luxustafel für Wenige und einen ausreichend mit Brosamen bestückten Katzentisch für die Vielen gekennzeichnet war.
1912 war das allgemeine Wehrrecht für Männer eingeführt worden, was 1916 durch die Verarmung breiter Bevölkerungsschichten erstmals zu einer als sozialdemokratisch bis linksliberal einzuordnenden Regierung führte. Diese wurde in ihrer politischen Gestaltrungskraft jedoch rasch durch interne Machtkämpfe gehemmt. Entsprechend änderte sich an den gesellschaftlichen Verhältnissen und der sehr ungleichen Eigentumsverteilung so gut wie nichts.
Die Weltwirtschaftskrise ab 1930 traf Argentinien zwar nur mäßig hart, aber als Reaktion kam es zu einem rechts-autoritären Putsch wie in vielen Teilen der Welt in diesen besonders schwierigen Zeiten. Damit waren die Verhältnisse wieder auf dem Niveau von vor 1916 angelangt: Operetten-Präsidenten aus der Oligarchie sorgten dafür, dass die Großgrundbesitzer und Bergbau-Magnaten weiter ungestört ihre Millionen scheffeln konnten und den 90 Prozent armen Menschen ging es eben so schlecht, wie es armen Leute in den dreißiger Jahren des letzten Jahrhundert nun mal ging.
Der Zweite Weltkrieg wirkte sich für ganz Südamerika relativ positiv aus, da keines der Länder direkt involviert oder gar betroffenen war und der Bedarf der Kriegsparteien an Nahrungsmitteln und Rohstoffen sich als immens erwies.
Der bescheidene Aufschwung wirkte sich auch am Katzentisch aus und stärkte das Selbstbewusstsein der Gewerkschaften- Die sorgten dafür, dass ab 1946 der Offizier Juan Peron an die Macht kam, der eine Art rechtspopulistische Form der Machtausübung etablierte, in denen erstmals auch Interessen außerhalb der vierzig führenden Familien des Landes wahrgenommen wurden. Das brachte spürbare Verbesserungen für die Masse der normalen ArgentinerInnen, jedoch soll auch erwähnt werden, dass Perons Herangehehnsweise sich rechtsnational mit sozialen Einschlag verortete. Seine aus Film und Musical bekannte Frau Evita hatte großes Massenpopulistisches Talent und unterstützte effektiv den Machterhalt ihres Gatten. Perons Verdienst liegt sicher in der in Angriff genommenen Industrialisierung, wodurch erstmals dann nicht nur der Agrarsektor und die Rohstoffe zur wirtschaftlichen Gesamtleistung beitrugen. In Perons zehnjährige Herrschaft fallen das erste argentinische Auto und Flugzeug, es entstand ein verarbeitendes Gewerbe, sodass Rohstoffe bereits im Land veredelt werden konnte und damit ein wichtiger Teil der Wertschöpfungskette in der heimischen Wirtschaft verblieb. Zahlreiche deutsche Ingenieure und Techniker fanden nach dem Zweiten Weltkrieg eine zweite Heimat in Argentinien, wo sie vor unangenehmen Fragen, was sie währen der nationalsozialistischen Herrschaft so gemacht hatten, sicher waren.
Weil das hier ein Wirtschafts- und kein Geschichtspodcast ist, sehen wir uns nun die Aspekte der Wirtschaftspolitik Perons genauer an. Wie fast alle Nationalisten fuhr er eine strenge protektionistische Handelspolitik – Importe wurden erschwert bis verunmöglicht – was eben dann auch zum ersten argentinischen Auto, Flugzeug, Nähmaschinenhersteller und so weiter führte. Ebenfalls passend in nationale Schema waren eine deutlich staatsdirigistische Wirtschaftspolitik, welche die stark in die Abläufe eingriff und ihm die Gegnerschaft der Oligarchie einbrachte, über die er später stürzen würde. Weiterhin schob Peron viele industrielle Großprojekte wie Straßenbau, Flughäfen und anderes an und verstaatlichte die großen Industrien. Die staatlich dirigierte Wirtschaft wurde über Fünfjahrespläne geleitet, Preise z.B. in den Restaurants oder für Nahrungsmittel waren festgesetzt und freie markwirtschaftliche Aktiviäten konnten nur noch in Nischenbereichen stattfinden.
Viele dieser Maßnahmen fanden sich damals vergleichbar in staatssozialistischen Ländern, insbesondere auch in der Sowjetunion. Dennoch war Peron kein Linker, ebenso wenig wie die staatssozialistischen Diktaturen jemals wirklich links waren. Peron strebte für Argentinien nach nationaler Größe, was durch Industrialisierung und Aufholen des Abstands zur Supermacht USA gelingen sollte.
Wirtschaftlich und gesellschaftlich änderte sich in den zehn Jahren von Perons Herrschaft allerdings alles. Der Einfluss der Großgrundbesitzer nahm ab, Bergwerke wurden verstaatlicht und Millionen von Menschen arbeiteten erstmals nicht mehr für die reichen Familien sonderen in den staatlichen Industrien oder in neu entstandenen Firmen, die wir heute neudeutsch Start-Ups nennen würden.
Dies schuf erstmals in Argentinien einen breiteren Massenwohlstand. Obwohl hier im Vergleich für die ganz große Masse kein allzu gutes Niveau erreicht wurde, haben Wirtschaftswissenschaftler errechnet, dass es den ArgentinierInnen nie wieder so gut ging, wie unter Peron. Das ist eine krasse Feststellung, denn inzwischen sind 68 Jahre vergangen und man muss lange suchen, um einen Staat zu finden, dessen Menschen heute schlechter als vor 70 Jahren leben.
Was sind die Ursachen für diese bedauerliche Abwärtsentwicklung?
Zunächst muss festgestellt werden, dass die Wirtschaftspolitik Perons zahlreiche Erfolge und auch viele Misserfolge aufweist. Was überwiegt scheint schwer herauszuarbeiten, denn das Ergebnis hängt, wie so oft davon ab, was der Forscher zu finden wünscht. Objektiv lässt sich sagen, dass Argentinien am Ende von Perons zweiter Amtszeit sich in eher langsamen wirtschaftlichen Entwicklung vergleichbar mit anderen lateinamerikanischen Ländern befand. Wenn wir das allerdings einmal auffieseln können wir sagen:
Der Masse der ArgetinierInnen ging 1955 besser als je zuvor, und wie heute wissen, auch jemals danach.
Die Oligarchen-Familien hatten Einbußen hinzunehmen, auch weil eben der Agrarsektor nicht mehr so im Vordergrund stand – lebten aber weiterhin überdurchschnittlich gut, Wenn wir es etwas plakativ formulieren wollen: es konnte nur noch alle zwei Jahre eine neue Yacht gekauft werden.
Auch andere Machtinstitutionen wie die katholische Kirche musste Verluste hinnehmen und bekämpfte die neue Politik erbittert..
Peron musste für seinen großen Sprung nach vorne viele Schulden machen, die allmählich zu drücken begannen. Er konnte zahlreiche seiner Programme mehr nicht so leicht finanzieren. Die staatlich festgelegten Preise mussten angehoben werden, gleichzeitig sank das Lohnniveau partiell oder stieg zumindest nicht im inzwischen gewohnten Maße. Die Gewerkschaften, die ihre Interessen nicht mehr wie gewünscht umgesetzt sahen, entzogen Peron die Machtbasis und es kam zu einem Putsch.
Politisch kam es in den Folgejahre zu instabilen Situationen und vielen Wechseln. Alle Akteure hatten jedoch von der Oligarchie einen klaren Auftrag erhalten: Perons Reformen rückgängig zu machen! Die verschiedenen Operetten-Präsidenten lieferten: Privatiserung der Staatsbetriebe und der Infrastruktur, Abbau von Zöllen und Handelshemmnissen, Abbau von Sozialleistungen und staatlichen Sicherheiten, Preisfreigabe und Reduktion des staatlichen Sektors.
Wenn mal ein Präsident nicht so funktionierte wie gewünscht, sich einfach ungeschickt anstellte oder das Volk zu viel Widerstand bot, dann putschte eben das Militär.
Die Folgen waren wie gewünscht: die Oligarchen-Familien saßen wieder fest im Sattel der Macht, auf dem Präsidententhron tummelten sich willfährigen Marionetten, die Geschäfte der Großagrarier liefen wieder wie geschmiert und das ganze Industriezeug ließ man wieder sein, weshalb Argentinien ab 1960 wieder fast ausschließlich Nahrungsmittel und Rohstoffe exportierte.
Nicht überraschend verarmte die Bevölkerung bei diesem Wandel, was durch eine hohe Geldentwertung - Inflationsraten durch die Jahrzehnte um 40 Prozent pro Jahr - zusätzlich verschärft wurde.
Es muss klar ausgesprochen werden: die Politik der Nach-Peron Zeit in Argentinien war grottenschlecht, weil das die Elite so wünschte und das Wohlergehen des Volks egal war. Das mündete in ein so solches gesellschaftliches und wirtschaftliches Chaos, das Argentinien vom Primus in Lateinamerika fast zum Schlusslicht abstieg. In der Not holte man 1973 sogar Peron aus dem Exil zurück, der aber bis zu seinem Tod ein Jahr später nichts Substantielles mehr ausrichten konnte. Danach kam seine dritte Frau – also nicht Evita, sondern Ehefrau Nummer drei namens Isabel formal an die Macht, war aber nur ein Aushängeschild rechter Peronisten, die Fäden zogen, besser gesagt: immer mehr aus der Hand verloren. Guerrillagruppen und Paramilitärs führten lokale Bürgerkriege und der Abstieg zum failed state war komplett. Natürlich putschte mal wieder das Militär und eine rechte Junta sorgte mit Terror und Folter für Ordnung und Ruhe im Staat. Wirtschaft war da nebensächlich, riesige Inflationsraten und eine Staatspleite 1982 waren die Folge. Die Generäle suchten nach altem Muster das Heil im militärischen Abenteuer, hatten sich aber bei der Besetzung der Falklandinseln den falschen Spielpartner herausgesucht. Die Briten warfen die Argentinier von der Insel und die Generäle dankten ab. Sie hinterließen ein psychologisch und wirtschaftlich völlig zerstörtes Land. Bis 1989 war Argentinien zahlungsunfähig. Erst mit den sogenannten Brady-Bonds, nach dem damaligen US-Finanzminister Brady benannt, konnte schließlich wieder schrittweise finanzielle Bewegungsfreiheit für das marode Land hergestellt werden. Die Brady-Bonds funktionierten vereinfacht so: Ein Darlehngsgeber hat Schuldverschreibung über 2 Millionen Pesos. Diese sind wertlos, weil der Pesos praktisch wertlos ist und außerdem Argentinien nicht zahlen kann. Dieser Schuldschein kann dann der Kreditgeber, es sei in unserem Beispiel eine Bank, in einen Bradybond von 20.000 Dollar umwandeln. Damit macht sie zwar Verlust, aber sie hat eine gesicherte Schuldverschreibung in einer handelbaren Währung auf die sie sogar weiter Zinsen bekommt. So kam Argentinien aus Pleite, bis zum nächsten mal, nur elf Jahre später, 2001.
Nach dem Ende der Militärdiktaturen kamen wechselnde demokratische gewählte Politiker an die Macht, immer wieder auch sogenante Peronisten, die der Partei Juan Peron angehörten, aber nicht daran dachten, seine Wirtschafts- und Sozialpolitik zu betreiben.
Im Prinzip entwickleten sich die Peronisten nach dem Ende der Militärdiktatur ab 1983 zur größten Volkspartei Argentiniens, die sich in einen sozialdemokratischen und einen wirtschaftsliberalen Flügel teilt. Weder der einen noch der anderen Richtung gelang es in den letzten 20 Jahren, Argentinien wieder aus dem Sumpf zu ziehen. Mehrere Staatspleiten, Währungsreformen und Krisenjahrzehnte später, steht Argentinien weiter mit eineinhalb Füßen im Abgrund.
Dabei fehlte es nicht an radikalen Maßnahmen. Wegen des eigentlich seit 1956 bestehenden Problems der massiven Inflation kam der neoliberale Präsident Menem 1991 auf den Gedanken, den Peso fix 1 zu 1 an den Dollar zu binden. Die Grundprinzipien der Wechselkurse und die Probleme eine Währungsbindung haben wir schon in unserem Podcast zu Währungen besprochen – bei Interesse gerne nachhören.
Menem erreichte zunächst sein Ziel, die Inflation sank erstmals seit Jahrzehnten. Zu welchen Preis, das wollen wir uns jetzt zum Abschluss ansehen. Die Prinzipien der Währungsbindung erforderte, dass für jeden Peso der im Umlauf war, ein Dollar auch als Devisenreserve vorgehalten werden musste. Da sie gar nicht so viele Dollar beßaß, wie benötigt, musste die Regierung daher den Peso-Umlauf begrenzen. Übersetzt bedeutet das: der Peso war zwar stabil, aber die Leute bekamen nur sehr wenige davon, die Möglichkeit Geld bar abzuheben wurde begrenzt.
Der nächste Nachteil bestand in allgemein steigenden Preisen. Wegen der Dominanz des Dollars im Weltwirtschaftssystem haben fast alle Waren einen internationalen Dollarpreis. Wenn der Peso jetzt 1 zu 1 an den Dollar gekoppelt ist, dann werden diese Waren auch in Argentinien dieses internationale Preisniveau aufweisen. Normalerweise sind in einem einkommensschwachen Schwellenland jedoch die Preise niedriger als das internationale Niveau. Das gleiche Prinzip wirkte sich in umgekehrter Weise auf die Löhne aus. Da die ArgentinierInnen nun im Prinzip Löhne in der Hartwährung Dollar erhielten, mussten diese in einem marktwirtschaftlichen System zwangsläufig sinken, denn das Produktivitätsniveau gab es nicht her, den Peso-Lohn quasi 1 zu 1 in Dollarlohn zu überführen. Die Folge für die Masse der ArgentinierInnen waren also steigende Preise und sinkende Löhne, was den positiven Effekt der Geldstabilität weitgehend wieder aufhob.
Am ungünstigsten wirkte sich jedoch aus, dass das Grundwirkprinzip der Wechselkurse, die Stärke einer Volkswirtschaft in ihrem Wechselkurs-Wert widerzuspiegeln, außer Kraft gesetzt wurde. Normalerweise wäre der argentinische Peso sehr wertarm gewesen, damit wären die Exporte des Landes preisgünstig und konkurrenzfähig gewesen. So aber konnte Nachbarländer wie Brasilien, die teilweise ganz ähnliche Waren exportierten, Argentinien fast völlig aus dem Markt drängen.
Bei der nächsten große Pleite 1998 wurde das Experiment daher als gescheitert abgebrochen.
Seither sind 25 Jahre vergangen, die Lage hat sich nicht gebessert.
So haben die Menschen nach eigentlich ziemlich langer Gedulds- und Leidenszeit jedes Vertrauene in eine herkömmliche Regierung verloren und einen wenig geeignet erscheinenden Kettensägen-Freak an die Spitze gewählt. Der will nicht nur das Dollarexperiment eine Stufe höher wiederholen, indem er den Peso ganz abschafft, sondern glaubt auch keine Zentralbank mehr zu brauchen.
Das Leiden der argentinischen Menschen geht weiter.
Die unerfreuliche Geschichte zeigt, wie ein von Natur aus reiches Land durch eine kleine egoistische Elite und korrupte PolitikerInnen über Jahrzehnte in Armut und gesellschaftlichen Chaos gehalten werden kann.
Episode und Musik von Frederick Liberatout.
Anregung und Kritik an moneycracy@riseup.net
This podcast features music created by F. Liberatout using Groovepad. Free available on Google Play and Apple Store,
|
Kommentare
|
|
| 25.06.2024 / 18:16 | Monika, bermuda.funk - Freies Radio Rhein-Neckar |
|
in sonar
|
|
| am 25.6.. Vielen Dank ! | |
| 26.06.2024 / 08:17 | Sabine und MAx, Radio Dreyeckland, Freiburg |
|
gespielt im MimoRa
|
|
| Danke | |