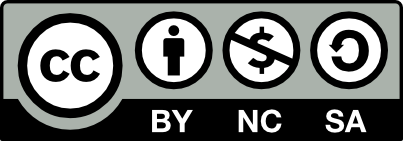Zölle – Trumps aktuelle Methode, für eine Weltwirtschaft zugunsten der Reichen MC#21
ID 134178
Der amerikanische Präsident kündigt im Eiltempo bestehende Zoll- und Freihandelsabkommen und belegt nahezu alle US-amerikanischen Importe mit Strafzöllen. Damit destabilisiert er nicht nur die eigene Wirtschaft, sondern bringt auch große Teile der Welt in Schwierigkeiten. Zölle sind ein uraltes Übel und eigentlich glaubte man ihre negative Macht sei im Zeitalter der Globalisierung weitgehend überwunden.
Die damit verbundene allgemeine Verteuerung der Waren trifft vor allem einkommensschwache Schichten.
Die damit verbundene allgemeine Verteuerung der Waren trifft vor allem einkommensschwache Schichten.
Audio
21:37 min, 19 MB, mp3
mp3, 125 kbit/s, Stereo (44100 kHz)
Upload vom 15.03.2025 / 18:30
21:37 min, 19 MB, mp3
mp3, 125 kbit/s, Stereo (44100 kHz)
Upload vom 15.03.2025 / 18:30
Dateizugriffe: 1417
Klassifizierung
Beitragsart: Gebauter Beitrag
Sprache: deutsch
Redaktionsbereich: Wirtschaft/Soziales, Politik/Info
Serie: Moneycracy
Creative Commons BY-NC-SA
Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen erwünscht
Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen erwünscht
Skript
Zölle – Trumps aktuelle Methode, für eine Weltwirtschaft zugunsten der Reichen
Der amerikanische Präsident kündigt im Eiltempo bestehende Zoll- und Freihandelsabkommen und belegt nahezu alle US-amerikanischen Importe mit Strafzöllen. Damit destabilisiert er nicht nur die eigene Wirtschaft, sondern bringt auch große Teile der Welt in Schwierigkeiten. Zölle sind ein uraltes Übel und eigentlich glaubte man ihre negative Macht sei im Zeitalter der Globalisierung weitgehend überwunden.
In dieser Folge beschäftigt sich Moneycracy also mit Zöllen. Das Grundsystem ist so alt wie die halbwegs zivilisierte Menschheit. Bereits in prähistorischer Zeit wurden von den damals noch spärlich gesäten Handelreisenden für die Passage bestimmter Abschnitte der Handelsroute eine Gebühr verlangt. Im wesentlich handelte sich dabei um eine organisierte Form dessen, was später als Raubrittertum bekannt wurde. Wer einen wichtigen Pass, eine Furt oder sonstige Engstelle, die nicht gut zu umgehen war, kontrollierte, stellte einige kräftige Kerle mit Keulen und Äxten dahin und kassierte die Weggebühr. Die Römer professionalisierten wie so vieles auch diesen Ansatz, sie waren nach aktuellem Wissensstand die ersten mit ausgebildeten Zöllnern in eigener Uniform.
Der Wohnort des Autors verdankt seine Existenz dem Schnittpunktes zweier wichtiger, uralter Handelsrouten, weshalb bereits in vorrömischer Zeit die Kelten auf einem passenden Berg eine Burg errichteten, um die Reisenden und Handelnden abzukassieren. Die Römer, Franken, Staufer und alle Nachfolger bis in die frühe Neuzeit führten die einträgliche Tradition fort.
Wer innerhalb der Kleinstaaterei des heiligen römischen Reichs Handel treiben wollte oder musste, hatte sich ein wahrlich ungünstiges Geschäftsfeld ausgewählt. Alle paar Kilometer lauerte die nächste Grenze und mit Waren passieren durfte nur, wer zahlte. Das verteuerte die Güter von Grenze zu Grenze, ohne dass es irgendeine Gegenleistung oder Aufwertung gegeben hätte. Die Kleinfürsten füllten ihre Taschen ausschließlich mit der Androhung von Gewalt und unterschieden sich strukturell nicht von den Raubrittern auf ihren Burgen, die für sogenanntes ‚sicheres Geleit‘ ihre Abgaben kassierten.
Zölle waren also zunächst nichts weiter als erpresstes Geld für die Herrschenden. Die dänischen Könige erhoben über 600 Jahre den sogenannten Sundzoll, indem sie an der Meerenge des Öresunds Kanonen aufstellten und alle Schiffe, die nicht bezahlten, versenkten. Damit konnte das dänische Königshaus über viele Generationen große Teile seines Haushalts decken. Erst 1850 beendetet Dänemark auf Druck der großen Seefahrtnationen diese Praktik der Seeräuberei. Die USA hatten für die zollfreie Passage durch die dänischen Meerengen sogar mit Waffengewalt gedroht.
Es gab schon früh Brücken- oder Passzoll. Immerhin wurde dafür eine Gegenleistung erbracht, eben die Brücke oder die Passstraße, die ja errichtet und unterhalten werden musste. Dennoch waren auch diese Einrichtungen Gelddruckmaschinen, mit dem Unterschied, dass sie immerhin eine Handelserleichterung boten.
Über lange Zeiträume waren Zölle also abgepresste Passagegebühren, welche die Tresore der Herrschenden füllten und die Handelswaren für alle teurer machten. Der Preis für eine Ladung Tuch konnte sich von Brabant in Belgien bis München locker vervierfachen, ohne dass irgendetwas für die Nutzer der Textilie besser geworden wäre oder der Händler für seine Dienstleistung des Transports etwas bekommen hätte. Zölle minderten also den Wohlstand aller, in dem sie den Wohlstand einiger Herrscher mehrten.
Mit dem Aufkommen der Nationalstaaten und der Wirtschaftsform des Merkantilismus – hört bei Bedarf dazu gerne unseren Moneycracysendung dazu an – kamen bei der Zollerhebung neue Zielsetzungen hinzu. Der Merkantilismus beruhte im Wesentlichen darauf, dass die neu entstandenen Nationalstaaten danach trachteten, möglichst viele Fertigwaren zu exportieren und wenige zu importieren. Um den Import also zu unterbinden, wurden Zölle auf Importfertigwaren erhoben, welche diese teurer als die einheimisch produzierten machten. Da dieses Schema alle entwickelten merkantilen Staaten anwandten, verteuerten sich die Waren überall stark und der allgemeine Wohlstand sank und wiederum füllte sich die Schatulle des Herrschers mit klingendem Gold.
Nachdem dieses Prinzip eingeführt und verstanden war, entstanden die bis heute gebräuchlichen Schutzzöllen, welche heimische Hersteller vor einem überlegenen ausländischen Wettbewerb schützen sollte.
Die englische Tuchfabrikation des 18. und 19. Jahrhunderts war wegen ihrer frühen Mechanisierung und dem guten Zugriff auf Wolle allen anderen überlegen. Ihre Waren von guter Qualität konnten zusätzlich vergleichsweise preisgünstig angeboten werden. Wenn ein Schneider in Sachsen also Tuch brauchte, bekam er es am besten aus England, was dem sächsischen König im Hinblick auf seine eigenen Tuchmanufakturen nicht passte. Daher belegte er englisches Tuch mit so hohen Zöllen, dass die sächsische Produkte billiger waren und daher gekauft wurden. Die Schneider bekamen so schlechtere Ware zu höheren Preisen. Das führte in der Folge dazu, dass auch die Kleidung des Kunden gleichzeitig schlechter und teurer war, als sie hätte sein müssen.
Das Prinzip wird bis heute angewandt. Um die eigene, nicht so wettbewerbsfähig Industrie zu schützen, werden Importe mit Zöllen belegt. Darin kann man in manchen Situationen und Konstellationen durchaus einen temporären Sinn erkennen. Hätte man nach der Wende eine größere Zahl der DDR Betriebe erhalten wollen, hätte man für das DDR-Gebiet Westprodukte mit hohen Zöllen belegen und so der Ostwirtschaft einige Jahre Zeit geben müssen, sich an den Wettbewerb des Westens anzupassen. Das war dann wegen rascher Wiedervereinigung und Einführung der D-Mark praktisch wie strukturell nicht durchführbar und von den KapitaleignerInnen und auch den Herrschenden der BRD nicht gewünscht.
In vielen Ländern der Welt werden jedoch einzelne Sektoren der Wirtschaft durch effektive Zölle geschützt. Die Zölle auf chinesische Elektroautos sollen beispielsweise die europäischen Autohersteller schützen, weil sie bislang nicht so preisgünstige E-Autos wie die Chinesen herstellen können. Weil Zölle, wie wir an den oben dargestellten Beispiel erläuter, zum Nachteil der Masse und des wirtschaftlichen Wohlstands möglichst Vieler erhoben werden, wird meist ein zusätzliches, quasi moralisch rechtfertigendes, Argument genannt. Das chinesische E-Auto sei nicht deshalb so preisgünstig, weil die Autobauer im Reich der Mitte die Technologie schon besser rationalisiert haben und vor allem über eine Batterieeigenproduktion verfügen, also eine überlegene Produktivität haben – nein, nein. Der Grund sei, dass die chinesische Regierung die Autobauer unzulässig subventioniert. In der Tat ist die staatliche Subvention die kleine oder manchmal auch große Schwester des Zolls und in ihrem Effekt ähnlich negativ.
Europäische Solar- und Batteriehersteller fordern seit Jahren Subventionen, damit sie ihre Produkte so günstig wie die asiatischen Anbieter anpreisen können und damit Wettbewerbsfähig bleiben. Es ist also ein staatliches Eingreifen von zwei Seiten mögliche: Zölle machen Importwaren teurer um einheimische Hersteller zu schützen, Subventionen verbilligen die einheimischen Produkte und machen sie wettbewerbsfähiger. Der Unterschied besteht aus Sicht des Staates darin, wer den gewünschten Ausgleich bezahlt. Subventionen muss der Staat bezahlen, meist von Geld, das er nicht hat. Unter anderem über Streitfragen zu Subventionen zum Beispiel im Bausektor und Verkehrsbereich ist jüngst die Ampelkoalition zerbrochen. Zölle sind aus Sicht der Herrschenden viel angenehmer, denn da zahlen die Händler und letztlich die Bevölkerung und das ganze spült auch noch klingende Münze ins Staatssäckel. Kein Wunder dass Trump sich primär für die Zollvariante entscheidet.
Aus inzwischen recht gut verstandenen Zusammenhänge sind jedoch beide, Zölle wie Subventionen, für die Gesamtwohlstandsentwicklung schädlich.
Wir können das an einem sehr berühmten, weltweiten Feldversuch der jüngeren Geschichte betrachten. Die Stahlproduktion stellte bis etwa 1970 einen extrem wichtigen Industriebereich, eine sogenannte Schlüsselindustrie in allen wichtigen Wirtschaftsnationen dar. Die Produktion von Stahl war praktisch gleichbedeutend mit Großindustrie und Bilder von Stahlwerken standen in vielen Ländern stellvertretend für Fortschritt und Wirtschaft schlechthin. Ab etwa 1970 ließ mit Ende der Wiederaufbauphase und des Nachkriegsbooms jedoch die Stahlnachfrage deutlich nach, es bestanden Überkapazitäten in allen produzierenden Ländern. Dies hatte gewaltige wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen, denn hier handelte es sich nicht um einige Hundert Beschäftigte wie bei den heutigen Diskussionen um die Förderung von Solarpanelherstellern, sondern um den Wirtschaftsmotor ganzer Regionen weltweit. Bis heute wirkt der Niedergang der Stahlindustrie der USA im sogenannten Rustbelt, einem großen Gebiet im Osten der USA nach. Der Wegfall so bedeutender Beschäftigungsmöglichkeiten ohne einen angemessenen Umgang damit führte zu Verarmung und Perspektivlosigkeit ganzer Bevölkerungsanteile. Bruce Springsteen, der im Rustbelt aufgewachsen ist, beschreibt den Niedergang und die Agonie dieser weitläufigen Gebiete in Songs wie Youngstown oder My hometown – hört euch das gerne mal in einer ruhigen Minute an.
Was Pittsburgh und Umgebung geschah, betraf in ähnlicher Weise Nottingham, Manchester, Essen, Saarbrücken oder die Wallonie – ganze Industrieregionen, die zuvor das industrielle Herz des Landes gebildet hatten, versanken in Armut und Perspektivlosigkeit. Aber bis es soweit war, versuchten zunächst alle stahlproduzierenden Nationen ihre Werke durch Zölle zu schützen. Dies verteuerte den Stahl weltweit für alle Beteiligten. Damit aber nicht schlimm genug, der teure Stahl sorgte dafür, dass immer mehr Ersatzmaterialien für den Werkstoff entwickelt und genutzt wurden. Anders ausgedrückt, der künstlich über Zölle verteuerte Stahl fand noch weniger Nachfrage, was das Problem der Stahlreviere weiter verschärfte.
Es handelte sich bereits um 1970 um eine sehr alte Industrie, viele Standorte waren ineffizient, notwendige Rohstoffe in der Nachbarschaft, insbesondere Eisenerz und billige Energie in Form von Kohle waren abgebaut. Die reduzierte Nachfrage hätte am besten von den verbleibenden effektiven Stahlproduzenten weltweit gedeckt werden können. Es bestand jedoch das dringende staatlich Bedürfnis und natürlich das Interesse der KapitaleignerInnen, die traditionellen Industriegebiete Nordenglands, Nordfrankreichs, Belgiens oder des Ruhrgebiets zu schützen, vor allem um den eigenen Profit weiterhin zu erwirtschaften. Das hat letztlich nirgendwo funktioniert, innerhalb von 20 Jahren waren fast alle traditionellen Reviere geschlossen. Bis dahin hatte das Hinauszögern des Strukturwandels viel Geld gekostet und Stahl und die daraus produzierten Waren für alle Menschen verteuert.
Den Strukturwandel großer Wirtschaftszweige über Subventionen abzufedern, ist aus bestimmten Perspektiven dennoch sinnvoll. Den entsprechenden Bereichen muss ein akzeptables Zeitfenster zur Umstellung gegeben werden. Wohin es führt, wenn aus einer ideologisch geleiteten Politik der Nichteinmischung in die private Wirtschaft einem radikalen Wandel freien Lauf gelassen wird, zeigte im Zusammenhang mit der Stahlkrise der Rustbelt der USA. Hier verarmten ganze Regionen und die Menschen verfielen der Perspektivlosigkeit und in Teilen auch den Drogen und letztlich Donald Trump, womit sich der Kreis zu zum Anfang unserer Podcasts wieder schließt.
Umgekehrt muss ebenfalls bedacht werden, dass Subventionen Steuergelder sind, also Mittel die allen BürgerInnen vom Staat abgepresst werden. Man kann eine nicht wettbewerbsfähige Industrie nicht längerfristig über die Zwangsfinanzierung durch die Allgemeinheit am Leben halten. Die Kohleförderung in Deutschland ist ein schönes Beispiel für eine zu lange und widersinnige Subventionierung, welche durchaus eine Folge der engen Verflechtung von KapitaleignerInnen und Politik in alten großen Industrieregionen ist. Deutsche Kohle zu verfeuern war schon lange nicht mehr wirtschaftlich und mindestens seit 30 Jahren war bekannt, dass es auch enorm unökologisch ist. Dennoch werden die Abbauwünsche großer Energiekonzerne bis auf den heutigen Tag vom Staat gegen den Widerstand weiter Bevölkerungsteile durchgesetzt und die Kohlewirtschaft jährlich mit Subventionen im Milliardenbereich gepampert. Es ist ein ganzes Geflecht vom direkten und indirekten Subventionen, das dafür sorgt, dass immer noch Kohlestrom durch unsere Computer fließt.
Von den oft widersinnigen Subventionen zurück zu Trumps neuem Lieblingsspielzeug, den Zöllen. Die nordamerikanische Freihandelszone NAFTA wurde 1994 zwischen den USA, Canada und Mexiko vereinbart und damit wurden Zölle zwischen diesen Ländern obsolet. In der negativen Beurteilung der Freihandelszone sind sich so unterschiedliche Akteure wie Donald Trump oder die mexikanischen Zapatisten einig. Trump nannte bereits 2017 das Nafta Abkommen . Die Zapatistische Bewegung bezeichnete 1993 das Abkommen als ‚Todesurteil für die indigene Communities in Mexiko‘. Die Zapatistische Kritik entzündete sich primär daran, dass diese Abkommen den Schutz Indigenen Landes vor Privatisierung, wie er in der mexikanischen Verfassung seit 1917 verankert war, aushebelte. Die Zapatista erklärten daher der mexikanischen Zentralregierung am 01.01.1994, als das Abkommen in Kraft trat, den Krieg und haben seither im Süden des Landes eine realle Alternative für die dort lebenden Menschen geschaffen, welche auf einer gemeinsam vonunten bestimmten Wirtschaft und Lebensweise statt auf Privateigentum aufgebaut ist.
Wir können an dieser Stelle die Regularien der NAFTA Abkommens nicht detailiert darstellen, jedoch sei ein Blick auf einen spezifischen Effekt geworfen. Wir hatten die Stahlkrise und den Niedergang der US-Stahlindustrie dargestellt. Selbstverständlich hat eine so große Industrienation wie die USA immer noch einen nicht unbedeutenden Stahlbedarf. Canada und Mexiko liefern als Importeure Nummer 1 und 3 große Teile des benötigten Stahls. Bedenkt man weiterhin, dass die abgehängte ArbeiterInnenschaft des Rustbelts einer der bedeutendsten Wählerpotentiale für Trump darstellt, ist klar, weshalb der neue Präsident sich die Zölle auf Stahlimporte aus den beiden Nachbarländern keinesfalls ausreden lassen wird.
Die Nachbarn reagieren auf den Bruch des Abkommens mit Gegenzöllen und die Waren werden für die Menschen in allen drei Ländern teurer, die Wirtschaft in ganz Nordamerika wird leiden, vor allem für normale Menschen, da sie Anteilig viel mehr von ihrem Einkommen für Importwaren ausgeben als reiche Menschen. So wirken Zölle auch immer als Mittel der Umverteilung – von unten nach oben. Leider werden die MAGA-Jünger die Konsequenzen dieser verfehlten Politik weder verstehen noch zuordnen können.
Wir sollten in den nächsten Jahren diese Entwicklung aufmerksam verfolgen, denn auch hierzulande gibt es vielen Menschen gerade aus dem progressiven und linken Spektrum, die in Freihandelsabkommen jeder Art – nicht ganz unberechtigt - Teufelswerk sehen.
Auf das NAFTA Freihandelszone und ihre Effekte auf die drei beteiligten Länder werden wir im nächsten Podcast eingehen.
Ouellen: Trumprede: https://www.youtube.com/watch?v=ct1BLP1RLgo (öffentlich zugängliche Quelle)
Episode und Musik von Frederick Liberatout.
Anregung und Kritik an moneycracy@riseup.net
Der amerikanische Präsident kündigt im Eiltempo bestehende Zoll- und Freihandelsabkommen und belegt nahezu alle US-amerikanischen Importe mit Strafzöllen. Damit destabilisiert er nicht nur die eigene Wirtschaft, sondern bringt auch große Teile der Welt in Schwierigkeiten. Zölle sind ein uraltes Übel und eigentlich glaubte man ihre negative Macht sei im Zeitalter der Globalisierung weitgehend überwunden.
In dieser Folge beschäftigt sich Moneycracy also mit Zöllen. Das Grundsystem ist so alt wie die halbwegs zivilisierte Menschheit. Bereits in prähistorischer Zeit wurden von den damals noch spärlich gesäten Handelreisenden für die Passage bestimmter Abschnitte der Handelsroute eine Gebühr verlangt. Im wesentlich handelte sich dabei um eine organisierte Form dessen, was später als Raubrittertum bekannt wurde. Wer einen wichtigen Pass, eine Furt oder sonstige Engstelle, die nicht gut zu umgehen war, kontrollierte, stellte einige kräftige Kerle mit Keulen und Äxten dahin und kassierte die Weggebühr. Die Römer professionalisierten wie so vieles auch diesen Ansatz, sie waren nach aktuellem Wissensstand die ersten mit ausgebildeten Zöllnern in eigener Uniform.
Der Wohnort des Autors verdankt seine Existenz dem Schnittpunktes zweier wichtiger, uralter Handelsrouten, weshalb bereits in vorrömischer Zeit die Kelten auf einem passenden Berg eine Burg errichteten, um die Reisenden und Handelnden abzukassieren. Die Römer, Franken, Staufer und alle Nachfolger bis in die frühe Neuzeit führten die einträgliche Tradition fort.
Wer innerhalb der Kleinstaaterei des heiligen römischen Reichs Handel treiben wollte oder musste, hatte sich ein wahrlich ungünstiges Geschäftsfeld ausgewählt. Alle paar Kilometer lauerte die nächste Grenze und mit Waren passieren durfte nur, wer zahlte. Das verteuerte die Güter von Grenze zu Grenze, ohne dass es irgendeine Gegenleistung oder Aufwertung gegeben hätte. Die Kleinfürsten füllten ihre Taschen ausschließlich mit der Androhung von Gewalt und unterschieden sich strukturell nicht von den Raubrittern auf ihren Burgen, die für sogenanntes ‚sicheres Geleit‘ ihre Abgaben kassierten.
Zölle waren also zunächst nichts weiter als erpresstes Geld für die Herrschenden. Die dänischen Könige erhoben über 600 Jahre den sogenannten Sundzoll, indem sie an der Meerenge des Öresunds Kanonen aufstellten und alle Schiffe, die nicht bezahlten, versenkten. Damit konnte das dänische Königshaus über viele Generationen große Teile seines Haushalts decken. Erst 1850 beendetet Dänemark auf Druck der großen Seefahrtnationen diese Praktik der Seeräuberei. Die USA hatten für die zollfreie Passage durch die dänischen Meerengen sogar mit Waffengewalt gedroht.
Es gab schon früh Brücken- oder Passzoll. Immerhin wurde dafür eine Gegenleistung erbracht, eben die Brücke oder die Passstraße, die ja errichtet und unterhalten werden musste. Dennoch waren auch diese Einrichtungen Gelddruckmaschinen, mit dem Unterschied, dass sie immerhin eine Handelserleichterung boten.
Über lange Zeiträume waren Zölle also abgepresste Passagegebühren, welche die Tresore der Herrschenden füllten und die Handelswaren für alle teurer machten. Der Preis für eine Ladung Tuch konnte sich von Brabant in Belgien bis München locker vervierfachen, ohne dass irgendetwas für die Nutzer der Textilie besser geworden wäre oder der Händler für seine Dienstleistung des Transports etwas bekommen hätte. Zölle minderten also den Wohlstand aller, in dem sie den Wohlstand einiger Herrscher mehrten.
Mit dem Aufkommen der Nationalstaaten und der Wirtschaftsform des Merkantilismus – hört bei Bedarf dazu gerne unseren Moneycracysendung dazu an – kamen bei der Zollerhebung neue Zielsetzungen hinzu. Der Merkantilismus beruhte im Wesentlichen darauf, dass die neu entstandenen Nationalstaaten danach trachteten, möglichst viele Fertigwaren zu exportieren und wenige zu importieren. Um den Import also zu unterbinden, wurden Zölle auf Importfertigwaren erhoben, welche diese teurer als die einheimisch produzierten machten. Da dieses Schema alle entwickelten merkantilen Staaten anwandten, verteuerten sich die Waren überall stark und der allgemeine Wohlstand sank und wiederum füllte sich die Schatulle des Herrschers mit klingendem Gold.
Nachdem dieses Prinzip eingeführt und verstanden war, entstanden die bis heute gebräuchlichen Schutzzöllen, welche heimische Hersteller vor einem überlegenen ausländischen Wettbewerb schützen sollte.
Die englische Tuchfabrikation des 18. und 19. Jahrhunderts war wegen ihrer frühen Mechanisierung und dem guten Zugriff auf Wolle allen anderen überlegen. Ihre Waren von guter Qualität konnten zusätzlich vergleichsweise preisgünstig angeboten werden. Wenn ein Schneider in Sachsen also Tuch brauchte, bekam er es am besten aus England, was dem sächsischen König im Hinblick auf seine eigenen Tuchmanufakturen nicht passte. Daher belegte er englisches Tuch mit so hohen Zöllen, dass die sächsische Produkte billiger waren und daher gekauft wurden. Die Schneider bekamen so schlechtere Ware zu höheren Preisen. Das führte in der Folge dazu, dass auch die Kleidung des Kunden gleichzeitig schlechter und teurer war, als sie hätte sein müssen.
Das Prinzip wird bis heute angewandt. Um die eigene, nicht so wettbewerbsfähig Industrie zu schützen, werden Importe mit Zöllen belegt. Darin kann man in manchen Situationen und Konstellationen durchaus einen temporären Sinn erkennen. Hätte man nach der Wende eine größere Zahl der DDR Betriebe erhalten wollen, hätte man für das DDR-Gebiet Westprodukte mit hohen Zöllen belegen und so der Ostwirtschaft einige Jahre Zeit geben müssen, sich an den Wettbewerb des Westens anzupassen. Das war dann wegen rascher Wiedervereinigung und Einführung der D-Mark praktisch wie strukturell nicht durchführbar und von den KapitaleignerInnen und auch den Herrschenden der BRD nicht gewünscht.
In vielen Ländern der Welt werden jedoch einzelne Sektoren der Wirtschaft durch effektive Zölle geschützt. Die Zölle auf chinesische Elektroautos sollen beispielsweise die europäischen Autohersteller schützen, weil sie bislang nicht so preisgünstige E-Autos wie die Chinesen herstellen können. Weil Zölle, wie wir an den oben dargestellten Beispiel erläuter, zum Nachteil der Masse und des wirtschaftlichen Wohlstands möglichst Vieler erhoben werden, wird meist ein zusätzliches, quasi moralisch rechtfertigendes, Argument genannt. Das chinesische E-Auto sei nicht deshalb so preisgünstig, weil die Autobauer im Reich der Mitte die Technologie schon besser rationalisiert haben und vor allem über eine Batterieeigenproduktion verfügen, also eine überlegene Produktivität haben – nein, nein. Der Grund sei, dass die chinesische Regierung die Autobauer unzulässig subventioniert. In der Tat ist die staatliche Subvention die kleine oder manchmal auch große Schwester des Zolls und in ihrem Effekt ähnlich negativ.
Europäische Solar- und Batteriehersteller fordern seit Jahren Subventionen, damit sie ihre Produkte so günstig wie die asiatischen Anbieter anpreisen können und damit Wettbewerbsfähig bleiben. Es ist also ein staatliches Eingreifen von zwei Seiten mögliche: Zölle machen Importwaren teurer um einheimische Hersteller zu schützen, Subventionen verbilligen die einheimischen Produkte und machen sie wettbewerbsfähiger. Der Unterschied besteht aus Sicht des Staates darin, wer den gewünschten Ausgleich bezahlt. Subventionen muss der Staat bezahlen, meist von Geld, das er nicht hat. Unter anderem über Streitfragen zu Subventionen zum Beispiel im Bausektor und Verkehrsbereich ist jüngst die Ampelkoalition zerbrochen. Zölle sind aus Sicht der Herrschenden viel angenehmer, denn da zahlen die Händler und letztlich die Bevölkerung und das ganze spült auch noch klingende Münze ins Staatssäckel. Kein Wunder dass Trump sich primär für die Zollvariante entscheidet.
Aus inzwischen recht gut verstandenen Zusammenhänge sind jedoch beide, Zölle wie Subventionen, für die Gesamtwohlstandsentwicklung schädlich.
Wir können das an einem sehr berühmten, weltweiten Feldversuch der jüngeren Geschichte betrachten. Die Stahlproduktion stellte bis etwa 1970 einen extrem wichtigen Industriebereich, eine sogenannte Schlüsselindustrie in allen wichtigen Wirtschaftsnationen dar. Die Produktion von Stahl war praktisch gleichbedeutend mit Großindustrie und Bilder von Stahlwerken standen in vielen Ländern stellvertretend für Fortschritt und Wirtschaft schlechthin. Ab etwa 1970 ließ mit Ende der Wiederaufbauphase und des Nachkriegsbooms jedoch die Stahlnachfrage deutlich nach, es bestanden Überkapazitäten in allen produzierenden Ländern. Dies hatte gewaltige wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen, denn hier handelte es sich nicht um einige Hundert Beschäftigte wie bei den heutigen Diskussionen um die Förderung von Solarpanelherstellern, sondern um den Wirtschaftsmotor ganzer Regionen weltweit. Bis heute wirkt der Niedergang der Stahlindustrie der USA im sogenannten Rustbelt, einem großen Gebiet im Osten der USA nach. Der Wegfall so bedeutender Beschäftigungsmöglichkeiten ohne einen angemessenen Umgang damit führte zu Verarmung und Perspektivlosigkeit ganzer Bevölkerungsanteile. Bruce Springsteen, der im Rustbelt aufgewachsen ist, beschreibt den Niedergang und die Agonie dieser weitläufigen Gebiete in Songs wie Youngstown oder My hometown – hört euch das gerne mal in einer ruhigen Minute an.
Was Pittsburgh und Umgebung geschah, betraf in ähnlicher Weise Nottingham, Manchester, Essen, Saarbrücken oder die Wallonie – ganze Industrieregionen, die zuvor das industrielle Herz des Landes gebildet hatten, versanken in Armut und Perspektivlosigkeit. Aber bis es soweit war, versuchten zunächst alle stahlproduzierenden Nationen ihre Werke durch Zölle zu schützen. Dies verteuerte den Stahl weltweit für alle Beteiligten. Damit aber nicht schlimm genug, der teure Stahl sorgte dafür, dass immer mehr Ersatzmaterialien für den Werkstoff entwickelt und genutzt wurden. Anders ausgedrückt, der künstlich über Zölle verteuerte Stahl fand noch weniger Nachfrage, was das Problem der Stahlreviere weiter verschärfte.
Es handelte sich bereits um 1970 um eine sehr alte Industrie, viele Standorte waren ineffizient, notwendige Rohstoffe in der Nachbarschaft, insbesondere Eisenerz und billige Energie in Form von Kohle waren abgebaut. Die reduzierte Nachfrage hätte am besten von den verbleibenden effektiven Stahlproduzenten weltweit gedeckt werden können. Es bestand jedoch das dringende staatlich Bedürfnis und natürlich das Interesse der KapitaleignerInnen, die traditionellen Industriegebiete Nordenglands, Nordfrankreichs, Belgiens oder des Ruhrgebiets zu schützen, vor allem um den eigenen Profit weiterhin zu erwirtschaften. Das hat letztlich nirgendwo funktioniert, innerhalb von 20 Jahren waren fast alle traditionellen Reviere geschlossen. Bis dahin hatte das Hinauszögern des Strukturwandels viel Geld gekostet und Stahl und die daraus produzierten Waren für alle Menschen verteuert.
Den Strukturwandel großer Wirtschaftszweige über Subventionen abzufedern, ist aus bestimmten Perspektiven dennoch sinnvoll. Den entsprechenden Bereichen muss ein akzeptables Zeitfenster zur Umstellung gegeben werden. Wohin es führt, wenn aus einer ideologisch geleiteten Politik der Nichteinmischung in die private Wirtschaft einem radikalen Wandel freien Lauf gelassen wird, zeigte im Zusammenhang mit der Stahlkrise der Rustbelt der USA. Hier verarmten ganze Regionen und die Menschen verfielen der Perspektivlosigkeit und in Teilen auch den Drogen und letztlich Donald Trump, womit sich der Kreis zu zum Anfang unserer Podcasts wieder schließt.
Umgekehrt muss ebenfalls bedacht werden, dass Subventionen Steuergelder sind, also Mittel die allen BürgerInnen vom Staat abgepresst werden. Man kann eine nicht wettbewerbsfähige Industrie nicht längerfristig über die Zwangsfinanzierung durch die Allgemeinheit am Leben halten. Die Kohleförderung in Deutschland ist ein schönes Beispiel für eine zu lange und widersinnige Subventionierung, welche durchaus eine Folge der engen Verflechtung von KapitaleignerInnen und Politik in alten großen Industrieregionen ist. Deutsche Kohle zu verfeuern war schon lange nicht mehr wirtschaftlich und mindestens seit 30 Jahren war bekannt, dass es auch enorm unökologisch ist. Dennoch werden die Abbauwünsche großer Energiekonzerne bis auf den heutigen Tag vom Staat gegen den Widerstand weiter Bevölkerungsteile durchgesetzt und die Kohlewirtschaft jährlich mit Subventionen im Milliardenbereich gepampert. Es ist ein ganzes Geflecht vom direkten und indirekten Subventionen, das dafür sorgt, dass immer noch Kohlestrom durch unsere Computer fließt.
Von den oft widersinnigen Subventionen zurück zu Trumps neuem Lieblingsspielzeug, den Zöllen. Die nordamerikanische Freihandelszone NAFTA wurde 1994 zwischen den USA, Canada und Mexiko vereinbart und damit wurden Zölle zwischen diesen Ländern obsolet. In der negativen Beurteilung der Freihandelszone sind sich so unterschiedliche Akteure wie Donald Trump oder die mexikanischen Zapatisten einig. Trump nannte bereits 2017 das Nafta Abkommen . Die Zapatistische Bewegung bezeichnete 1993 das Abkommen als ‚Todesurteil für die indigene Communities in Mexiko‘. Die Zapatistische Kritik entzündete sich primär daran, dass diese Abkommen den Schutz Indigenen Landes vor Privatisierung, wie er in der mexikanischen Verfassung seit 1917 verankert war, aushebelte. Die Zapatista erklärten daher der mexikanischen Zentralregierung am 01.01.1994, als das Abkommen in Kraft trat, den Krieg und haben seither im Süden des Landes eine realle Alternative für die dort lebenden Menschen geschaffen, welche auf einer gemeinsam vonunten bestimmten Wirtschaft und Lebensweise statt auf Privateigentum aufgebaut ist.
Wir können an dieser Stelle die Regularien der NAFTA Abkommens nicht detailiert darstellen, jedoch sei ein Blick auf einen spezifischen Effekt geworfen. Wir hatten die Stahlkrise und den Niedergang der US-Stahlindustrie dargestellt. Selbstverständlich hat eine so große Industrienation wie die USA immer noch einen nicht unbedeutenden Stahlbedarf. Canada und Mexiko liefern als Importeure Nummer 1 und 3 große Teile des benötigten Stahls. Bedenkt man weiterhin, dass die abgehängte ArbeiterInnenschaft des Rustbelts einer der bedeutendsten Wählerpotentiale für Trump darstellt, ist klar, weshalb der neue Präsident sich die Zölle auf Stahlimporte aus den beiden Nachbarländern keinesfalls ausreden lassen wird.
Die Nachbarn reagieren auf den Bruch des Abkommens mit Gegenzöllen und die Waren werden für die Menschen in allen drei Ländern teurer, die Wirtschaft in ganz Nordamerika wird leiden, vor allem für normale Menschen, da sie Anteilig viel mehr von ihrem Einkommen für Importwaren ausgeben als reiche Menschen. So wirken Zölle auch immer als Mittel der Umverteilung – von unten nach oben. Leider werden die MAGA-Jünger die Konsequenzen dieser verfehlten Politik weder verstehen noch zuordnen können.
Wir sollten in den nächsten Jahren diese Entwicklung aufmerksam verfolgen, denn auch hierzulande gibt es vielen Menschen gerade aus dem progressiven und linken Spektrum, die in Freihandelsabkommen jeder Art – nicht ganz unberechtigt - Teufelswerk sehen.
Auf das NAFTA Freihandelszone und ihre Effekte auf die drei beteiligten Länder werden wir im nächsten Podcast eingehen.
Ouellen: Trumprede: https://www.youtube.com/watch?v=ct1BLP1RLgo (öffentlich zugängliche Quelle)
Episode und Musik von Frederick Liberatout.
Anregung und Kritik an moneycracy@riseup.net
|
Kommentare
|
|
| 19.03.2025 / 09:17 | JR, Radio Dreyeckland, Freiburg |
|
Gesendet
|
|
| Im Morgenradio gespielt. Danke! <3 | |